Allgemein
Januar 22

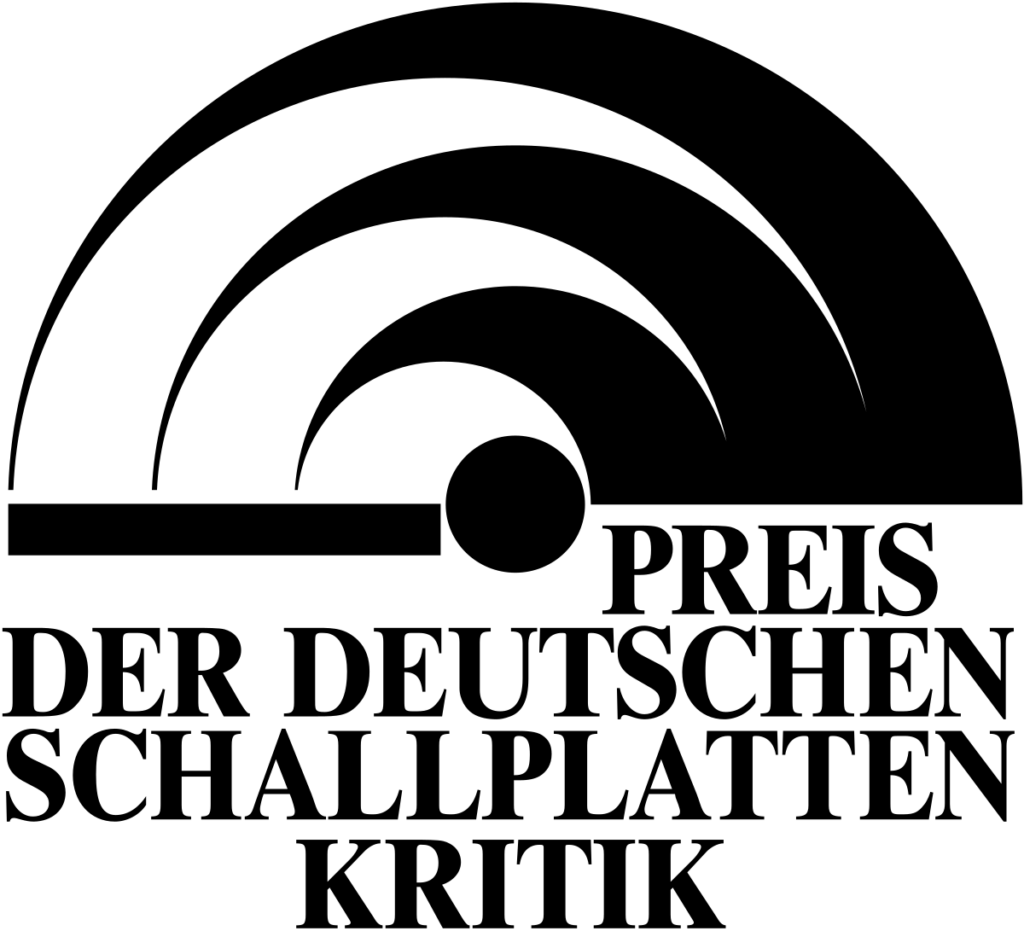 Ein Sturmtief wird erwartet, da erreichte mich eine Nachricht aus Mannheim: die im November 2021 erschienene CD „novemberblues – Deutschlands neunte November“ ist auf der „LIEDERBESTENLISTE“ zum „Album des Monats“ und der Titel „Ich war ich bin ich werde sein“ zur Empfehlung des Monats gewählt worden.
Ein Sturmtief wird erwartet, da erreichte mich eine Nachricht aus Mannheim: die im November 2021 erschienene CD „novemberblues – Deutschlands neunte November“ ist auf der „LIEDERBESTENLISTE“ zum „Album des Monats“ und der Titel „Ich war ich bin ich werde sein“ zur Empfehlung des Monats gewählt worden.
Auch die „Jury Liedermacher“ beim „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ findet das Album offensichtlich preiswürdig und hat das Album daher nominiert.
Mein Dank gilt den beteiligten Musikern und Produzenten. Beteiligte werden ausführlich im Booklet gewürdigt.
Die für den März 2022 bereits geplante Tournee mit „novemberblues“ verhindert allerdings Omikron. Zum Heulen, wo doch die Premiere im Kesselhaus der Kulturbrauerei soooo toll war. Ich danke nochmal allen die dabei waren, auf, hinter und vor der Bühne.

CD-Release am 1.11.2021 im Kesselhaus Berlin
Der lange Anlauf
… 17.00 Uhr…
…normalerweise wäre jetzt Hektik auf der Bühne der Kulturbrauerei in Berlin, gerade wären wir beim Soundcheck unseres neuen Programms „novemberblues“ – Der 9. November der deutschen Geschichte. Das Programm hatte, nein, hätte am 9.11.2020 Premiere haben sollen: Plakate waren gedruckt, geklebt, Flyer verteilt, der Flügel angemietet, das Catering bestellt, die Musiker verpflichtet… Aber der Lockdown, Verhinderer des ersten, zweiten und heute, des dritten Premieren-Versuchs, hat voll reingehauen. Kann die Tatsache, dass es den meisten Kollegen genauso geht, trösten? Ja, sicher!
Der vierte Anlauf, novemberblues auf die Bühne zu bringen, ist nun der 1.11. 2021. Karten für das Programm behalten ihre Gültigkeit, d.h. wenn bis dahin umfänglicher geimpft, als über die theoretische Möglichkeit, irgendwann eine Impfung zu erhalten, palavert wird.
Seit ca. zwei Jahren beschäftige ich mich mit dem sogenannten Schicksalstag der Deutschen, dem 9.11., für dessen (Be) Deutung vor allem Ereignisse der neunten November von 1918, 1938, 1989 Zeugnis ablegen. Aber es gab noch andere schicksalsträchtige 9. November: 1848, 1920, 1923, 1939, 1945, 1948, 1967… und bei diesen interessierten mich mehr die Schicksale Einzelner. So z.B. die Biografie des Paulskirchen-Abgeordneten Robert Blum (10.11.1807 – 9.11.1848), einer der bekanntesten Politiker seiner Zeit, der für einen deutschen Nationalstaat stritt, in dem Bürger- und Menschenrechte für jeden gelten sollten. Mit der Ermordung Blums am 9.11.1848 starben die demokratischen Hoffnungen jener Zeit. Sie sollten erst 70 Jahre später, am 9.11.1918 wieder auferstehen.
Die Geschichte des Kunstschreiners Johann Georg Elser (4.1.1903 – 9.4.1945), der in der Nacht vom 8. zum 9.11.1939 im Münchner Bürgerbräukeller ein Attentat auf Hitler und seine Mitbanditen verübte, das nur knapp scheiterte, weil Hitler und seine Entourage aus Witterungsgründen den Ort verfrüht verließen, ist mehrmals verfilmt worden. Was für ein Land wäre Deutschland wohl heute, wenn Elsers Attentat – er rechtfertigte sich immer wieder mit seiner Erkenntnis: „Friede oder Hitler“ – zielführend gewesen wäre?
Ich singe ein Lied über den 17jährigen deutsch-polnischen Juden Herschel Feibel Grünspan, der am Vorabend der Reichspogromnacht in der Deutschen Botschaft in Paris auf den Legationsrat Ernst vom Rath schoss.
Ich erzähle und singe über den polnischen Kinderarzt, Waisenhausdirektor, Schriftsteller, Pädagogen, Janusz Korczak, der die ihm anvertrauten Kinder aus seinem Waisenhaus im Warschauer Ghetto mit der Verheißung; „Kinder, wir fahren aufs Land hinaus“, in das Vernichtungslager Treblinka bis in den Tod, auch seinen eigenen, (7. 8.1942) begleitete. Ich stieß bei der Recherche über Korczak auf einen anderen Mann gleichen Namens. Nur ein „Z“ fehlt. Ferat Korcak, ehemaliger Neuköllner Linken-Abgeordneter dessen Pkw 2018 von Faschos abgefakelt wurde. Einer von diversen Brandanschlägen im Stadtbezirk Neukölln. Rechtsextreme, die „schon“ nach zwei Jahren dingfest gemacht werden konnten. Der Verdacht, dass Justitia auf dem rechten Auge blind ist….Wehret den Anfängen! Aber Hallo – was für Anfänge?
Auch das Abschiedsgedicht, das Adam Kuckhoff (Mitglied des Schulze-Bossen-Harnack-Kreises, von den Nationalsozialisten „Rote Kapelle“ getauft ) kurz vor seiner Hinrichtung für seine Frau Greta schreib, das ich in den 70er Jahren vertonte, gehört mit in dieses Programm.

Eine der schönsten Geschichten aber ist diese:
Am 9. November 1989 saß der russische Cellist Mstislaw Rostropowitsch in seiner Pariser Wohnung vor dem Fernseher und sah die Bilder vom Fall der Mauer. Euphorisiert buchte er für den nächsten Tag für sich, sein Cello und einen Freund Flüge nach Berlin. Ein Taxi brachte die beiden Männer und das Cello am 10.11.1989 an die Berliner Mauer. Rostropowitsch sagte zu seinem Freund, er wolle ein Dankbarkeitsgebet machen und etwas spielen, nur er allein.
Und er setzte sich nicht weit von der Mauer in der Nähe des Springer-Hauses auf einen ausgeliehenen Stuhl und spielte die Sarabande Suite von Bach. Etwa 20 Leute umstanden ihn. Einige weinten. Danach fuhren die beiden Freunde mit einem Taxi zum Flughafen zurück und tranken Champagner, bis die nächste Maschine nach Paris zurück flog. 1990 ist Mstislaw Rostropowitsch unter der Regierung von Gorbatschow in seine Heimat, die er 1974 verließ, zurück gekehrt. 2007 ist er in Moskau verstorben.
Und wie beendet man ein Song-Programm über das Schicksalsdatum der Deutschen? Am besten mit Musik. Oder?
Vielleicht irgendwas Knalliges, das Ohren, Lungen und Seele flutet, etwas zwischen Purple Rain und Pink Floyd?
Aber vorher noch die letzte Strophe des letzten Liedes:
jeda jehört zu ne Minderheit
ob Mann, ob Frau, ob Kind, ob Maus
der Tag zieht den Jahrhundertweg
und nu jehts Licht hier aus.
Und das Herz schlägt weiter links
Barbara Thalheim über ihr Leben in der DDR, ihre Lieder und eine Sturzgeburt
von Karlen Vesper
Ich habe sie schon immer bewundert, als eine starke, selbstbewusste, emanzipierte, kluge und talentierte Frau, als großartige Chansonnière und mutige Liedermacherin. Ob mit kurzgeschorenen Haaren oder üppiger Lockenmähne, es umgab sie stets eine Aura, der man sich nicht entziehen konnte. Sie hat Charisma. Doch erst jetzt, im persönlichen Gespräch, erfahre ich, dass Barbara Thalheim auch äußerst feinfühlig, verletzlich ist. Das Leben, die Zeit, hat ihr wunderbare Momente geschenkt, aber auch Wunden geschlagen, die nicht alle verheilt sind. In ihren Worten: »Glück und Enttäuschung, Lust, Frust und Wut, Erfolg und Niederlagen sind mir wie Schallplattenrillen in die Seele gebrannt.«
Sie schätzt sich selbst als schüchtern ein, nennt sich scherzhaft »rhythmische Ruferin« und bewundert die »exzellenten Stimmen« von Veronika Fischer und ihrer langjährigen, besten Freundin Aurora Lacasa, mit der sie Anfang der 70er Jahre am »Studio für Unterhaltungskunst« eine musikalische Ausbildung genossen hatte. Schon zu Beginn ihrer Karriere füllt Barbara Thalheim Säle, als sie mit »ihrem« Streichquartett, vier Studenten der Musikhochschule »Hanns Eisler«, durch das kleine Land tingelt, das die Springer-Presse noch mit Gänsefüßchen versieht: »Wir waren blutjung. Wir sangen vor großblumigen Wandtapeten und schmiedeeisernen Raumteilern, unter retuschierten Politikerbildern, vor drapierten Fahnen auf viel zu großen, viel zu hohen Bühnen.« Damals bringt die staatliche Schallplattenfima Amiga ihre erste Single heraus: »Frühling in der Schönhauser«, aufgenommen mit dem Günter-Gollasch-Orchester, am Piano Reinhard Lakomy. Barbara Thalheim steht in den folgenden Jahren mit dem Niederländer Herman van Veen, dem Franzosen Georges Moustaki, dem Österreicher Georg Danzer, mit Erika Pluhar, Hannes Wader, Konstantin Wecker und vielen anderen renommierten Künstlern auf der Bühne. Ab 1994 mit dem Franzosen Jean Pacalet, großartiger Konzert-Akkordeonist und Komponist. Und ihr neuer Lebensgefährte, bis zu dessen Tod vor bald zehn Jahren.
»Ich bin angekommen und nicht angekommen im vereinten Deutschland«, sagt Barbara Thalheim. Sie fühlt sich als eine »Unbehauste«. Am 2. Oktober 1990 verabschiedet sie mit Kollegen im Ostberliner »Prater« die DDR. Titel des Konzerts: »Der letzte macht das Licht aus«. Sie erinnert sich: »Die Stimmung im Prenzlauer Berg unterschied sich sehr von der am Reichstag, wo die offiziellen Feiern stattfanden. Auf dem Kollwitzplatz wurde um Mitternacht die Republik Utopia ausgerufen und wurden Pässe für Bürger dieser Republik verteilt.«
Über Nacht wird sie Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland. Sie kann sich nicht richtig freuen, ein undefinierbares Unbehagen beschleicht sie. Sie muss sich zurechtfinden im kapitalistischen Alltag mit überbordender Bürokratie, »schlimmer als bei uns einst«, nervigen Behördengängen und Steuererklärungen. All das, was sie von ihrer eigentlichen Bestimmung abhält. Was ist gewonnen, was verloren? Zwei Jahre nach der Vereinigung wägt sie in »So lebten wir in Zeiten der Stagnation«, verfasst mit dem Vater ihrer beiden Töchter, Fritz-Jochen Kopka, das Gestern und Heute: »Stimmt’s, da waren wir am Arsch/ Und da warn wir geborgen/ Da waren wir Held, da waren wir Clown/ Das Gestern bekannt wie das Morgen/ Die gemütlichen Zeiten der Stagnation.« Sie singt den Menschen im Osten – entlassen, abgewickelt, gewohnter sozialer Sicherheit verlustig und neue Freiheiten noch ungewohnt – aus dem Herzen: »Denkst du noch an die niedlichen Summen/ für Kunst und fürs Essen,/ für Miete und Pacht/ Und da waren die Klugen nicht meistens die Dummen/ die Skrupellosen nicht immer die Macht/ … Stimmt’s, wir machten uns klein und wir zeigten Größe/ Wir schrien unsern Frust durchs Telefon/ Der Staatspreis war wichtiger nicht als Klöße/ in den Innenräumen der Stagnation.« Sie bleibt sich treu. In der DDR hat sie den Stachel gelöckt, wider selbstgefällige Obrigkeit, gesellschaftliche Missstände, den Missbrauch einer Idee, die auch die ihre war. Nun beklagt sie Gleichgültigkeit, Geldgier, Ungerechtigkeiten, nicht nur hierzulande. »Die Welt zum Heulen/ aber keiner weint … Es ist die Kälte, die uns eint … Wer sich bekennt, der hängt am Kreuz zum Spott.«
Nein, nicht alles, vieles war nicht gut in der DDR. Und ja, Barbara Thalheim genoss das Privileg, reisen zu dürfen. Aber: Was heißt Privileg? Weltanschauung kommt von Welt anschauen. Barbara Thalheim resümiert: »Ich ging davon aus, dass es meine Kunst war, die mich privilegierte.« Und doch war es ein stetiges Bitten und Betteln.
Im November 1980 wird ihr mitgeteilt, dass eine lange vorbereitete Tournee durch die Bundesrepublik abgesagt wurde. Wegen der »augenblicklich besonders komplizierten Situation zwischen den beiden deutschen Staaten«. Bonn soll zur Anerkennung der DDR-Staatsbürgerschaft genötigt werden. Barbara Thalheim fragt: »Ja, und was haben meine Lieder damit zu tun?« Und welchen Wert haben Verträge, wenn sie erpresst werden? Vergebens. Ihre Westberliner Managerin wird per Telegramm von der zuständigen DDR-Künstleragentur über die Köpfe der Musiker hinweg informiert. Enttäuscht erklärt Barbara Thalheim, erst zwei Jahre Mitglied der SED, ihren Austritt aus der Partei. Und »fällt aus allen Wolken«, als sie drei Tage später in der ARD-Tagesschau erfährt: »Die DDR hat nach Angaben der Ostberliner Chansonsängerin Barbara Thalheim seit Ende vergangener Woche einen Ausreisestopp für Künstler verhängt, die zu Gastspielen in die Bundesrepublik oder nach Westberlin reisen wollten.« Sie wird ins ZK bestellt, muss eine Standpauke von Kurt Hager über sich ergehen lassen: »Und das bei deinen Vater!« Sie ist die Tochter eines Kommunisten, der im deutsch-faschistisch okkupierten Frankreich verhaftet und in die Hölle von Dachau verschleppt worden war. In ihrem Elternhaus sind Freunde aus Frankreich ein- und ausgegangen; mitunter war die Teenagerin eifersüchtig, ihren Vater mit den Kameraden aus der Résistance teilen zu müssen. Erst Jahre nach seinem Tod 1994 stößt sie auf dessen unveröffentlichte Memoiren im Bundesarchiv. Anderthalb Dezennien zuvor hatte sie seiner Generation mit dem »Höhlenlied« Ehre erwiesen: »Unsere Eltern sind die letzten Helden gewesen/ Sie haben gehungert, Broschüren gelesen… Sie wurden verstoßen, vergessen, umworben… Die Herzen geöffnet, die Seelen vermint/ Ihre Schuld war klein, ihre Kraft war groß/ Ihr Leben ging erst nach dem Ende los.« Ihr schien im Vergleich zu deren dramatischen Lebenswegen, Kämpfen und Visionen »alles so klein«, was in der DDR geschah und was man selbst tat.
Barbara Thalheim verteidigt sich trotzig gegenüber Ideologiechef Hager: »Ich will mit meinen Liedern Barrieren niederreißen.« Sie darf schließlich doch »rüber«, die restlichen Tourneetermine noch wahrnehmen. Nach ihrer Rückkehr aber wird sie aus der SED ausgeschlossen. Obwohl sie schon selbst ausgetreten ist. Die Exkommunizierung behalten sich die Genossen vor. Es hagelt Konzertabsagen: »Ich fiel in ein tiefes Loch.«
Doch Barbara Thalheim rappelt sich auf, kämpft. Drei Jahre darauf entsteht mit einer neuen Band ein neues Programm: »In der Nacht, in der Macht, in der Not ist der Mensch nicht gern alleine«. Die Menschen sind dankbar für ihre offenen Worte und Lieder, wie etwa »Hoher Besuch«: »Gestern kam der Staat bei mir vorbei: Ob ich auch zufrieden und so weiter sei/ Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll … Ich fragte, ob er selbst zufrieden sei.« Unerhörte Sätze, Bekenntnis und Verlangen: »Ich will auch irren dürfen./ Seitenwege gehen./ Die Zukunft träumen und den blausten Süden sehn …/ Du hegst die Braven und ihr permanentes Ja,/ Die Nachplapperer sind bei dir ganz dicke da,/ die wilden Denker, Sucher, sind dir gar nicht recht.«
1985 bestreitet sie 180 Konzerte republikweit. Als höhere Weihen empfindet sie eine Einladung in die Akademie der Künste. »Dienst nach Vorschrift« klagt die Entmündigung und Gängelung der Bürger durch den Staat an. »Die Reaktionen des Publikums von Blankenburg bis Wernigerode waren euphorisch«, freut sie sich noch heute. Die staatliche Nachrichtenagentur ADN vermerkt indes nur lakonisch: »Und so sang sie an gegen herzloses Verhalten und Spießertum.«
Unmut und Unruhe im Volk und unter den Künstlern mehren und entladen sich im Herbst 1989. Liedermacher und Rocksänger der DDR verfassen eine Resolution. Auch Barbara Thalheim verliest diese vor ihren Konzerten: »Die Partei- und Staatsführung bagatellisiert die vorhandenen Widersprüche. Es geht nicht um Reformen, die den Sozialismus abschaffen, sondern um Reformen, die den Sozialismus weiterhin möglich machen.« Am 40. Jahrestag der Republik, am 7. Oktober, erlebt sie in Dresden brutale Gewalt. Unvergessen ist ihr die friedliche Großkundgebung am 4. November auf dem Berliner Alexanderplatz. Fünf Tage darauf, am 9. November, sitzt sie in Wien in einer Talkshow des ORF mit dem orakelnden Titel »Wenn die Mauer fällt«. Während sie noch mit den anderen Gästen spätabends darüber in der »Käseglocke« eines Fernsehstudios sinniert, ist die Mauer in Berlin schon überwunden.
Wer ahnt da, dass gerade erst aufgestoßene Türen und Fenster sich bald wieder schließen werden, neue Mauern emporwachsen? »Auferstanden aus den Dogmen und dem Leben zugewandt«, eine Adaption der DDR-Nationalhymne, trägt Barbara Thalheim nun landauf, landab vor, bis zum März 1990 über hundert Mal. »Unsere Not war die des Denkens/ Und die Not der Mauern auch./ War die Not der stets Gelenkten/ Leeres Herz und voller Bauch. Wenn wir brüderlich uns einen/ Bleiben wir doch, wer wir sind,/ Bleiben wir auf eignen Beinen/ Und das Herz schlägt weiter links.«
Barbara Thalheim erinnert sich: »Immer wenn ich es sang, hatte nicht nur ich Tränen in den Augen.« Es kommt alles anders als erhofft. Schmerzhafter noch als alle Enttäuschungen und fatalen Folgen nach der Sturzgeburt »Einheit«, dem abrupten Abbruch eines Aufbruchs, war der Verlust von Freunden, von denen sie annahm, dass sie »aufrichtige Linke« wären. »Sie wurden, was sie zu DDR-Zeiten nie gewesen sind, angepasste Mitläufer.«
1992 tourt Barbara Thalheim mit der Rockband Pankow durch Deutschland. Sie nimmt als letzte DDR-Künstlerin in einem Tonstudio des bereits in Abwicklung befindlichen VEB Deutsche Schallplatten noch eine Amiga-Platte auf: »Das Ende der Märchen«. Vereinigungseuphorie weicht im Osten zunehmend Frust. Die Sturzgeburt Einheit wirft neue Gräben auf. Zur inneren Zerrissenheit des Landes trägt die Stasi-Hysterie bei. Die trifft auch Barbara Thalheim. Dabei hat sie selbst einen Journalisten, Karl-Heinz-Baum vom Berliner Büro der »Frankfurter Rundschau«, gebeten, nach ihrer Akte zu suchen. Mit 17 war sie in den Fokus der Staatssicherheit geraten; die familiären Koordinaten für eine Anwerbung schienen zu passen. Ein IM-Vorlauf wurde angelegt, den sie ohne Arg unterschrieb. Dann schläft der Kontakt ein. Vier Jahre später, nach ihrem SED-Ausschluss, wird die »Zusammenarbeit« eingestellt. Die Liedermacherin fällt nunmehr in die Rubrik »Operative Personenkontrolle«, heißt: Verdacht auf »feindlich-negative Handlungen«.
Täterin oder Opfer? Nach Aktenlage, nach Erkenntnis des Journalisten von der »Frankfurter Rundschau« und Bestätigung von Musikerkollegen hat sie niemanden verraten, niemanden ins Gefängnis gebracht, vielmehr über die Kulturpolitik der DDR geschimpft. Trotzdem meint 2017 eine Redakteurin der »Berliner Zeitung«, die Verdächtigungen und entkräfteten Vorwürfe noch einmal aufwärmen zu müssen. Um sich zu profilieren. Barbara Thalheim ersucht nach der Veröffentlichung des von ihr nicht autorisierten Textes um ein klärendes Gespräch in der Redaktion. »Es ging aus wie das Hornberger Schießen.« Ich spüre ihre innere Erregtheit noch heute. »Die Dame wusste nichts von mir. Sie kannte kein einziges Lied. Meine Akte, nicht von mir angelegt, ohne Schriftstücke von mir, war das Gerüst, an dem sich ihre Fragen entlang hangelten.«
Heiner Müller sagte einmal: »Ein Kadaver kann seinem Obduktionsbefund nicht widersprechen. Der Blick auf die DDR ist von einer Sichtblende verstellt, die gebraucht wird, um Lücken der eigenen ›moralischen Totalität‹ zu schließen.« Ein wahrlich weiser Mann.
Barbara Thalheim kann stolz sein. Sie hat 20 Tonträger veröffentlicht, ein Dutzend Bühnenprogramme gestaltet. »Wer darf sich anmaßen, über andere Leben zu urteilen?«, fragt sie. Und ist überzeugt: »Vereinigung funktioniert nur mit dem Rucksack bisher gelebten Lebens, mit allen Widersprüchen und Irrtümern. Die eigene Identität ist nicht unbedingt das, was andere dafür halten.« Günter Gaus, ein guter Freund, hat sie zu trösten versucht: »Warte ab, bis die BND-Akten veröffentlicht werden.« Sind sie bis heute nicht.
1995 gab Barbara Thalheim mit »Abgesang« ihren Bühnenabschied, den sie glücklicherweise drei Jahre darauf widerrief. Und so singt sie noch heute. Ihr neues Programm, »NOVEMBERblues«, befasst sich mit einem ambivalenten Datum deutscher Geschichte, dem 9. November 1848, 1918, 1923, 1938, 1939 – und 1989. Das letzte Lied, im Stil eines Bänkelgesangs und im Berliner Dialekt, wird Barbara Thalheim allein, ohne ihre großartigen Musiker, vortragen: »Jeda jehört zu ne Minderheit, ob Mann, ob Frau, ob Kind, ob Maus …« Ja, jeder und jede ist besonders.
(erschienen in „Neues Deutschland“ vom 3.10.2020)
Jean Pacalet 10.3.1951 – 7.7.2011

Heute ist der „Lautmaler unter den Tondichtern“ bereits acht Jahre tot.
Acht Jahre! Du fehlst, Jean.
Vor kurzem hat dich der Maler Hans W. Scheibner aus Maßlow porträtiert. Dabei hat er nur ein einziges Konzert mit dir und deiner wuchtigen PIGINI-Geliebten gesehen. Und das ist 10 Jahre her. Ganz plötzlich, erzählt er, stieg die Erinnerung an dieses Konzert von 2009 in Ahrenshoop, anlässlich einer Ausstellungseröffnung des Bildhauers Jo Jastram in ihm hoch und es entstand – du würdest sagen – „Jean Pacalet in Rost“…
Christoph Krumbholz hat es für eine kurze Sequenz zum Film gemacht. Natürlich mit deiner Musik, Jean.
Nicht ahnend, welche Irritationen ein fehlendes Pronomen beim deutschen Publikum hervorrufen kann, hast du deine Komposition „Sieben Stücke für Kinder“ bei Konzerten in Deutschland oft mit „Sieben Stück(e) Kinder“ angekündigt. So wie du auch nicht damit einverstanden warst, dass das Restaurant Wieseneck in Kloster auf der Insel Hiddensee kein „e“ am Wortende vertrug. Es gibt heute noch Hiddenseeer die – in memoriam an deine Konzerte und Inselsommer auf dem Eiland – bevorzugt in die „Wiesenecke“ gehen, wenn sie sich ein Feierabendbier gönnen.
Vor einigen Wochen rief mich ein französischer Theaterregisseur an. Er war auf der Suche nach den Noten deiner Bühnenmusik zu Goldinis „Das Café“, die du in den 90er Jahren für die comedie francaise in Paris geschrieben hattest. Ich fragte den Mann, warum er gerade nach dieser Partitur suchen würde? An die Inszenierung könne er sich kaum noch erinnern, dafür um so konkreter an deine „Bühnen-Geräusch-Musik-Collage“. Nur diese müsse es sein, wenn er das Stück im Herbst in der Bretagne zu inszenieren beginnt.
Auf deiner Homepage www.jean-pacalet.de, sind nun viele deiner Stücke transkribiert. Erik Kross sei DANK! Und allen Akkordeonisten, die sich bis jetzt Noten heruntergeladen haben haben, auch.
So bleibt dein Oeuvre in der Welt.
Sollst nicht das Gefühl haben, Jean, dass wir hier unten faul wären. Kannst dich da oben gemütlich zurücklehnen und deinen Chablis trinken.
Wir vergessen dich nicht.
Wir, das sind doch ganz schön VIELE!
Jean Pacalet 10 mars 1951 – 07 juillet 2011
Il y a huit ans nous a quittés l‘accordéoniste et compositeur français Jean Pacalet, ce « poète qui peignait avec des sons ». Huit ans déjà !
Jean, tu nous manques.
Il n’y a pas longtemps, le peintre Hans W. Schreibner, de Maßlow, a fait un portrait de toi. Il ne t’a vu qu’une seule fois en concert, avec ton accordéon imposant de la marque PIGINI. C’était il y a dix ans. Il m‘a dit que le souvenir de ce concert de 2009 a surgi lors d’un vernissage du sculpteur Jo Jastram … et il a peint ton portrait. Tu l’aurais sans doute appelé „Jean Pacalet en rouille“.
Christoph Krumbholz l‘a fait vivre dans une brève vidéo. Bien sûr avec ta musique, Jean.
Ignorant quelle perplexité pouvait provoquer l‘absence d’une préposition chez le public allemand, tu annonçais souvent ton œuvre „Sieben Stücke für Kinder“ (Sept morceaux pour enfants“) comme „Sieben Stücke Kinder“ (Sept morceaux d‘enfants).
Tu préférais aussi appeler „Wiesenecke“ le restaurant „Wieseneck“ à Kloster sur l’île de Hiddensee. Encore aujourd’hui les touristes – en mémoire de tes merveilleux concerts – préfèrent aller dîner au „Wiesenecke“.
Il y
a quelques semaines, un metteur en scène français me contactait, à la recherche
des partitions de la musique de scène de pour „Le café“ de Goldini que
tu avais écrite dans les années 90 pour la Comédie-Française. En réponse à ma
question de savoir pourquoi il recherchait précisément cette musique-là, il m’a
répondu qu’il se souvenait à peine de la mise en scène, mais parfaitement de la
musique: « Cc‚est génial, cette manière d’adapter la musique
concrète à la scène. »
En automne, en Bretagne, pour sa propre mise en scène de la pièce, il n’envisageait pas d’autre musique que la tienne.
Sur ton site www.jean-pacalet.de, géré par le compositeur Erik Kross, on peut trouver un grand nombre de transcriptions de tes oeuvres. Un grand merci à Erik ! Merci aussi à tous les accordéonistes qui les ont téléchargées.
S’il te plaît, Jean, ne dis pas qu‘ici bas, nous restons sans rien faire. Ce n’est pas vrai.
Mets-toi à l’aise là-haut pour siroter ton petit verre de Chablis.
Nous ne t’oublierons jamais !
Nach dem 70er Jahr…
Aus den Videomitschnitten der Geburtstagskonzerte vom Herbst 2017 – „voll jährig“ haben wir nun eine DVD erstellt, darauf die großartigen Gäste der beiden Abende in Leipzig und Berlin wie Pigor & Eichhorn, Alexandra Lachmann, Martin Buchholz, Marco Tschirpke, Michèle Bernard, Mark Chaet, Prof. Erich Krüger, die gemeinsam mit der Thalheimband und weiteren musikalischen Freunden an diesen Sonderkonzerten mitwirkten.
Ein paar visuelle Eindrücke vorab:
Der geburtstagsbegleitenden Presse mangelte es nicht gerade an Gemeinheiten. Die Reaktionen von Euch auf absolute Entgleisungen (z.B. der Leipziger BILDzeitung) waren dabei ein Trost.
Danke dafür, besonders an Prof. Dr. Hajo Funke, der sich – ohne mich persönlich zu kennen – die Mühe machte, Grundsätzliches dokumentarisch und journalistisch sauber zusammenzutragen. In Kürze wird auch sein Artikel auf meiner Webseite zu finden sein.
Hier zum Nachlesen und -schauen:
- Neues Deutschland, 2.9.2017
- Leipziger Volkszeitung, 29.8.2017
- der freitag, 21.9.2017
- rbb-Abendschau:
Die Proben am Programm „Vorsicht! Frau!“, eine Hommage an den Weltfrauentag im März (auf der Basis eines Projekts, das ich in den 80er Jahren für das Festival FEMINALE entwickelte), gehen in die letzte Runde. Konzerte damit gibt es am 8.3. in Magdeburg, 9.3. in Friedersdorf, 11.3. in Userin, am 13.3. in der Philharmonie Berlin und am 16.3. in Oderaue. Mehr dazu und zu Ticketvorbestellungen gibt es auf der >> TERMINSEITE.
Ein kleines Bonmot von Leif Johansson (Schwede, Ingenieur, Jahrzehnte im Vorstand der Volvo-Gruppe) zeigt ein wenig die Richtung von „Vorsicht! Frau!“ an:
„Die Weltbevölkerung umfasst zwei Gruppen von Menschen. Eine Mehrheit von 49% Männern und eine Minderheit von 51% Frauen“.
Im Programm auch der Song „Frau an der S-Bahn“. Dazu ein Video von Odette Lacasa:
Von April bis Ende Juni 2018 werde ich mich einem neuen Projekt widmen. In dieser Zeit wird es keine Konzerte geben.
Zum 6. Todestag von Jean Pacalet
07.07.2017
Heute vor 6 Jahren starb der Akkordeonist, Komponist und Arrangeur Jean Pacalet mit 61 Jahren in Berlin. Er war ein außergewöhnlicher Mensch und Freund. Wir denken an dich, Jeannot, sehen und hören dein Meisterwerk: „paysage sous la mer„. Michèle Bernard hat dir auf ihrer aktuellen CD ein Chanson gewidmet, „Montée des Anges„. Darin heißt es: „Du hast den Hügel der Engel erklommen und uns hier unten belämmert zurück gelassen… Wir warten auf dich, aber nichts passiert… Egel machen immer was sie wollen… und so schnell werden sie dich nicht loslassen… Sei gegrüßt Akkordeonmann, hast deinen letzten Hauch ausgespuckt, den Ozean und die Gezeiten in deinen Lungen versteckt… dein 7-Sterne-Pigini ist vom Lastwagen des Himmels gefallen….“
Michèle Bernard (www.michelebernard.net) ist mit diesem und anderen Liedern Gast des Jubiläumskonzertes von Barbara Thalheim am 8.9.2017 im Berliner Columbia-Theater.
Jean Pacalet, accordéoniste et compositeur, nous a quitté il y a 6 ans, à l’âge de 61 ans, à Berlin. Il était un homme et ami formidable. Nous ne t’avons pas oublié, Jeannot, et écoutons aujourd’hui ton œuvre sublime „Paysage sous la mer„. Nous vous recommandons la chanson de Michèle Bernard „Montée des Anges„, à vivre en direct le 8 septembre 2017au théâtre Columbia de Berlin, au concert „voll jährig“.

Wohin wir sterben
Gedanken nach dem Abschied von der Schauspielerin und Diseuse Gisela May
Noch nie trieb ich mich so oft auf Friedhöfen herum wie in meiner Pariser Zeit Anfang der neunziger Jahre. Die Unwirtlichkeit meines Aufenthalts in der Stadt der Liebe, der schönsten der Welt, wie immer behauptet wird, spülte mich in den ersten Wochen täglich dort hin, wo man nicht reden muss, auf Friedhöfe.
Auf dem Cimetière Montparnasse erinnerte das schlurfende Geräusch hunderter Besucherfüße auf den weißen Marmorkieselwegen an perkussive Botschaften aus meinem zurückgelassenen Leben als Sängerin in Berlin. Einmal kam ich dazu als eine Gruppe Schulmädchen im Diesseits des Jenseits auf Serge Gainsbourgs Grabplatte „Je t’aime moi non plus“ krähte und sich dabei stöhnend, tanzend seiner Klamotten entledigte. Für das Verständnis dieser Vorstellung braucht man keine Sprachkenntnisse. Ich fing an zu heulen. Die Botschaft war: Die Rückkehr der Toten beginnt, wenn wir ihre Abwesenheit als anwesend feiern.
Ich sah mich als Sechsjährige in den fünfziger Jahren an der Hand meines Atheististen-Vaters über den Leipziger Südfriedhof zum Grab meines Großvaters gehen. Wo ist Opa jetzt, fragte ich? Er ist nirgendwo, er ist tot, antwortete mein Vater. Eine unfassbare Antwort für ein Kind.
 Unweit meiner Berliner Wohnung befindet sich der Dorotheenstädtische Friedhof. Auf manchen Gräbern liegen immer wieder kleine Geschenke, Botschaften, persönliche Wünsche, adressiert an die Verstorbenen. Christa Wolfs Grab wird mit allerlei Schreibgerät bedacht. Kugelschreiber, Fineliner, Füller, Buntstifte, Kreide….Die werden alle paar Wochen von der Friedhofsverwaltung einkassiert, um dann von Besuchern, Verehrern wieder neu aufgefüllt zu werden.
Unweit meiner Berliner Wohnung befindet sich der Dorotheenstädtische Friedhof. Auf manchen Gräbern liegen immer wieder kleine Geschenke, Botschaften, persönliche Wünsche, adressiert an die Verstorbenen. Christa Wolfs Grab wird mit allerlei Schreibgerät bedacht. Kugelschreiber, Fineliner, Füller, Buntstifte, Kreide….Die werden alle paar Wochen von der Friedhofsverwaltung einkassiert, um dann von Besuchern, Verehrern wieder neu aufgefüllt zu werden.
Nun hat auch Gisela May nach ihrer Abschiedsfeier in Baumschulenweg ihre letzte Ruhestätte auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof gefunden. Was werden Besucher auf ihrem Grab ablegen? Vielleicht Fahrkarten als Nachweis weiter Anreisen, Belege der Mühe für eine letzte Verneigung vor La May, der Grande Dame des politischen Chansons.
Januar 2017. Friedhof Berlin-Baumschulenweg. Keine Gesangbücher. Kein Pfarrer. Keine Orgelmusik.
Gisela May hatte ihre Trauerfeier selbst geplant und auch den Ort dafür, die 1999 fertiggestellte Trauerhalle in Baumschulenweg, gewählt. Das Ensemble – Krematorium und Halle – wurde von den Architekten des Berliner Kanzleramtes Axel Schultes und Charlotte Frank entworfen. Man sieht es sofort. Und so war Gisela Mays letzter großer Auftritt fast ein Staatsbegräbnis.
Auf dem Podium leuchtendes Gelb. Van Goghs Gelb. In einem Meer aus Sonnenblumen war die Urne der Verstorbenen kaum zu sehen. Mir kam Marlene Dietrich in den Sinn. Sie wurde im Dezember geboren und starb im Mai. Gisela May wurde im Mai geboren und starb im Dezember. Die Dietrich gestattete im Alter keine Bild-Aufnahmen mehr von sich. „Ich bin zu Tode fotografiert worden,“ sagte sie zu Maximilian Schell, der das Kunststück vollbrachte mit der Schauspielerin einen letzten (Dokumentar) Film zu drehen, ohne sie dabei zu filmen.
Gisela May ließ sich auch im Alter gern fotografieren, bestimmte aber, dass bei ihrer eigenen Trauerfeier kein Foto gezeigt werden sollte.
Unter den Trauergästen für die Verstorbene, die 2000 den Verdienstorden des Landes Berlin und 2004 das Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse erhalten hatte, suchte man den Berliner Bürgermeister, den Intendanten des Berliner Ensembles, an dem sie dreißig Jahre engagiert war, die Präsidentin der Akademie der Künste, deren Mitglied Gisela May seit 1972 war, vergebens.
In der Presse hieß es, die Schauspielerin und Diseuse wäre im 93. Lebensjahr friedlich eingeschlafen. Nachrufe bemühen gern das Bild vom sanften Tod. Begriffe wie einschlafen und Frieden nehmen dem Tod das unfassbar Endgültige. Wer einschläft wacht auch wieder auf. Wenn nicht im Bett, dann aber doch im Himmel.
1984 setzte sich der 80jährige Psychiater T. St. aus Karl-Marx-Stadt, assistiert von einem Arzt-Freund inmitten seiner Lieben, die zu diesem Anlass angereist waren, die finale Spritze, ein Narkotikum. Der Psychiater schlief ein. Als er entschlafen war blieb die Familie um sein Bett versammelt. Man trank, aß, redete mit dem Toten und über ihn. Es wurde sogar gelacht. Das hat mir der Sohn des Psychiaters dreißig Jahre später erzählt. So oder ähnlich wünschen sich viele Menschen ihr Aus-dem-Leben-Scheiden, glaube ich.
Gisela May hatte keine eigene Familie. Sie lebte die meiste Zeit ihres langen Lebens allein. Ihr Vater Ferdinand May, Mitbegründer des Kulturbundes der DDR, war in den fünfziger Jahren als Chefdramaturg des Leipziger Theaters mit meinem Vater befreundet. Als Sechsjährige hörte ich den beiden Männern manchmal zu. Das Wort Chanson, das öfter vorkam in ihren Gesprächen, merkte ich mir, obwohl ich keine Ahnung hatte was man darunter versteht.
Seit der Jahrtausendwende waren viele Freunde und Kollegen von Gisela May gestorben. Auch ihr langjähriger Pianist Manfred Schmitz. Das Gefühl übrig zu bleiben macht einsam. Man verliert den Halt. Man verwechselt Bekanntschaft mit Freundschaft auf der Suche nach Ersatz für die abwesende Familie. Alle wollen alt werden, aber alt sein?
Die Französin Jeanne Calment starb mit 122 Jahren 1997 in Arles. Von ihr ist überliefert, dass sie bei jedem ihrer Geburtstage (ab dem hundertsten) sagte: Gott hat mich vergessen.
Gisela May war eine Kämpferin, nicht nur in Bezug auf ihre künstlerische Arbeit, in der sie Perfektionistin war. Sie kämpfte gegen schlimme Krankheiten. Aber gegen das Alter kann man nicht kämpfen. Als ein autarkes Leben für sie mehr und mehr unmöglich wurde, hofften Freunde und Betreuer, insbesondere ihre treueste Schülerin, aufopfernde Begleiterin und Vorleserin Johanna Arndt manchmal auch insgeheim auf Erlösung.
Jean Améry behauptet in seinen Essays über den Tod, dass vom Schicksal begünstigte, mit besonderen Gaben ausgestattete Menschen oft einen schweren Abschied haben. Als würden sie im Loslassen ihr Leben rückwärts und ins Gegenteil verkehrt durchleiden müssen.
Einmal habe ich Gisela May gefragt, wie sie ihre Erfolge als Bürgerin eines in der Welt nicht unbedingt immer gut angesehenen Landes, dazu noch im Kalten Krieg persönlich verarbeitet hat. Ich dachte dabei an ihre Triumphe in der Carnegie Hall New York, der Mailänder Scala, im Opernhaus Sydney, Pariser Olympia, um nur einige zu nennen. Ihre Antwort: durch Fleiß.

Hugenottenviertel
2002 wurden wir Nachbarinnen. Ich hatte Giselas Fürsprache bei unserem Vermieter meinen Einzug in die Berliner Hugenottensiedlung zu verdanken. Die berühmte Mieterin mit eigens ausgebautem Probenstudio im Dachgeschoss, hatte Anfang der 60er Jahre ihre Wohnung bezogen. Neben ihr wohnte bis zu ihrem Tod 1973 Elisabeth Hauptmann, Bertolt Brechts Mitarbeiterin.
Die wenigen verbliebenen Altmieter der Hugenottensiedlung können wunderbare Geschichten erzählen, Geschichten, die an Filmszenen erinnern. Zum Beispiel über Sommerfeste im verwunschenen Hausgarten. An langen Tafeln, bunt gedeckt, saßen die Familien der 30 Mietparteien. Höhepunkte dieser Treffen waren kleine Aufführungen durch die Kinder der Anwohner unter der Leitung der Schauspielerin Gisela May, die zu diesem Anlass ihren Kostümfundus freigab.
Voilà, der Vorhang – die Tür zum Garten – öffnete sich, die verkleidete Kinderschar führte vor, was die berühmte Schauspielerin mit ihnen einstudiert hatte.
Zu ihren eigenen Geburtstagen am 31. Mai kamen Freunde und Schauspielkollegen, Regisseure, Filmleute, Dramaturgen, Musiker, Nachbarn, Schüler und Schülerinnen und Mitarbeiter. Auch Politiker, Repräsentanten des untergegangenen und des heutigen Staates entstiegen mit Blumenbuketts und Kuchenbergen an der Grundstücksschranke ihren Dienstlimousinen. Wer La May in den letzten zehn Jahren öfter besuchte wusste, dass man bei Türöffnung durch die Jubilarin sogleich lossprechen musste. Gisela erkannte Menschen vornehmlich an ihren Stimmen. Altersbedingt war auf die Augen weniger Verlass als auf die Ohren. Zwischen den Besuchern huschten die geliebten Katzen umher, die vom „Vorkosten“ der kalten Platten abgehalten werden mussten.
Am 24.9.2001 schrieb mir Gisela: „…bin sehr gespannt, wie dein Abend im BE zustande gekommen ist. Leider kann ich nicht kommen, weil ich Gastspiel in Kopenhagen habe. Zu blöd. Meine letzte Erfahrung im BE am letzten Freitag: (sie gastierte seit 2000 wieder im Berliner Ensemble mit ihrem „Gisela May singt und spricht Kurt Weill“- Abend) Vorverkauf mäßig – Abendkasse glänzend. Also nicht verzagen! Leider macht das BE keinerlei extra Werbung. …Jetzt lief die 10. Vorstellung; Peymann hat den Abend nie gesehen…natürlich hast du es schwerer. Bei mir zieht ja nicht nur mein Name und meine 30jährige Zugehörigkeit zum BE, sondern auch der Name Weill….“
Tage später steckte meine Nachricht in ihrem Briefkasten: …. „war super und sogar voll. Unglaublich motivierte Bühnencrew! Ausführlich wenn wir uns sehen. Wenn ich eingezogen bin werde ich Visitenkarten mit: wohnhaft in der Chansonnettensiedlung … drucken lassen.
Auch am 31. Mai 2004 gastierte Gisela May mit ihren Brecht-Weill-Abend wieder im Berliner Ensemble. Am Ende des Konzertes regneten Rosenblätter aus dem Schnürboden auf Jubilarin herab. LA MAY stand, Blick auf den obersten Rang des Theaters gerichtet, an den Flügel gelehnt, von einem euphorischen Publikum gefeiert, auf der – ihrer – Bühne. Dieser Abend war war für mich ihr eigentlicher Bühnenabschied, ein Konzert, das nie wieder zu toppen sein würde. Die Besucher erhoben sich von den Plätzen als sie die Bühne betrat und auch als sie sie verließ. Kaum ein Zuschauer im Saal der nicht wusste, dass es ihr 80. Geburtstag war. Später erzählte sie mir, dass dieses Gastspiel gar nicht aus Anlass ihres Achtzigsten an sie herangetragen wurde. Das Datum war Zufall. Die Intendanz wusste erst gar nicht, dass sie ihr ehemaliges Ensemblemitglied zu einem Jubiläumskonzert gebeten hatte. Aber die Kollegen, Inspizienten, Beleuchter, Bühnenarbeiter, Garderobieren, Tontechniker wussten es. Sie hatten auch die Rosenblätter besorgt.
In die Wohnung von Gisela May ist eine Familie mit Kindern eingezogen. Ich sah sie am Abend ihres Einzugs in inniger Umarmung auf ihrem neuen, „Giselas“, Balkon stehen, als könnten sie ihr Glück kaum fassen.
Ob sie wissen, wer die Dielen ihrer geräumigen, sonnigen Wohnung vor ihnen zum Knarren brachte? Welche Höhenflüge, Räusche und Schicksalsschläge von ihrer berühmten Vormieterin über fünfzig Jahre lang in dieser Wohnung bewältigt wurden? Ich denke an den Schock der Kündigung durch das Berliner Ensemble 1992 nach dreißig Jahren Zugehörigkeit zum Haus. Wolf Kaiser, Gisela Mays Schauspielkollege und dienstältester Macky Messer am BE hat sich nach seinem Rausschmiss am 22.10.1992 aus dem Fester seiner Wohnung in der Friedrichstraße in den Tod gestürzt.
Auf dem Gelände der Hugenottensiedlung gibt es einen alten Maulbeerbaum. Er verweist auf die im 18. Jahrhundert auf Königlichen Befehl nicht nur auf diesem Grundstück verordnete Seidenraupenzucht. Stadtführer erzählen ihren Touristengruppen unter diesem Baum die Geschichte der protestantischen Glaubensflüchtlinge aus Frankreich, die man in Brandenburg und Preußen Réfugiés, erst später dann Hugenotten nannte.
Eine der Stadtführerinnen führt immer einen alten Kassettenrecorder mit sich. Nach ihrem Vortrag über die Hugenotten kommt er zum Einsatz. Mit ausladender Geste verweist die junge Frau auf das Haus hinter dem Maulbeerbaum. „Hier wohnt die berühmte Schauspielerin und Diseuse… hören wir jetzt ihr Lieblingslied „Es wechseln die Zeiten“ aus „Schwejk im zweiten Weltkrieg“ gesungen von Gisela May.
Die Touristenführerin studiert Schauspiel und möchte Chansonsängerin werden.
Ab jetzt wird sie an dieser Stelle ihres Vortrags sagen müssen: Hier wohnte über 50 Jahre…….
„……Es wechseln die Zeiten, die Nacht hat zwölf Stunden dann kommt schon der Tag….“

(eine gekürzte Fassung dieses Artikels erscheint am 25. März 2017 in der Tageszeitung „neues deutschland“).
Klick Klack
Ein Vorsatz für 2017: ab und an neue Songs im Arbeitsstadium vorzustellen. Dieser ist die Adaption eines neuen Chansons meiner verehrten Kollegin Michèle Bernard aus Lyon. Die Textübertragung hat mich allerdings ein wenig vom Original weggeführt. Auch weiß ich, dass Kolibris keine Schwarmvögel sind, doch aber gemeinsam ausschwärmen 😉
„Klick-Klack – Welt gerettet, eventuell“:
Frau Kraft, Gisela, Gisel, Giselchen…

Unterwegs mit einem Derwisch
Genau in dem Moment, als ich von Flugangst geschüttelt am 5. Januar 2010 um 8.15 Uhr meinen Sicherheitsgurt im Flugzeug nach Afrika festzog, starb im Krankenhaus in Bad Berka in Thüringen die Poetin, Schriftstellerin und Übersetzerin, meine Freundin Gisela Kraft in den Armen ihrer Schwester Reinhild an Krebs. Sie wurde 74 Jahre alt.
Genau in dem Augenblick, als ich am 19. Mai 2016 meine Seelenschublade mit den Erinnerungen an Gisela wieder schloss, starb Reinhild, Cellistin, „Mutterunser“, Giselas Lieblingsschwester, die auch mir nahe stand, im 71. Lebensjahr in Brandenburg.
… und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben… schrieb Mascha Kaleko als sie ihren Sohn verloren hatte. Die Konfrontation mit dem Tod geliebter Menschen wird gegenwärtig im Alter. Der Tod ist „eine Widerfahrung, die nicht mehr zur Erfahrung werden kann.“ (Silvia Bovenschen)
Ich klappe den Laptop zu, mache einige Runden ums Haus, komme zurück, lösche den Text zu Giselas 80. Geburtstag und fange von vorn an.
Mai 2016.
Ein warmer Mai in diesem Jahr. Seit Wochen begleitet mich Gisela bei Autofahrten durch die Rapsfelder Mecklenburgs, bei Erkundungen auf der Ile des Embiez, beim Bestaunen der Calanques (das sind vom Meer ausgewaschene bizarre Kalkfelsen) bei Cassis, sie ist bei Auftritten in Thüringen, Mecklenburg, Proben und auch an faulen Tagen dabei. Wir halten Zwiesprache, erinnern uns an Details unserer 26jährigen Weiberfreundschaft. Zwei unterschiedlich sozialisierte Frauen, die ungleicher nicht hätten sein können. Ich habe sie geliebt, die Stunden nach unseren gemeinsamen Lesung-Konzerten. Wir zwei in Kneipen von Rostock bis Suhl, von Pitschen bis Pickel (gibt es wirklich, sogar durch ein Gedicht Giselas belegt) beim Grappa trinken. Mir fällt niemand ein, der mich so oft zu Tränen rührte beim Lachen und beim Weinen.
Im November 1984 übersiedelte die Dichterin, Schriftstellerin, Islamwissenschaftlerin Gisela Kraft in ihrem 48. Lebensjahr von West- nach Ostberlin. Eine Sensation. Vor allem für Journalisten. Nur wenige drangen in den zahlreich erschienenen Zeitungs-, Film – und Fernsehberichten über die promovierte Islamwissenschaftlerin, die sich „freiwillig einsperren ließ“, zum tieferen Grund ihres Staatenwechsels vor. In ihrem nachgelassenen Manuskript „Mein Land ein anderes“ (Edition Azur 2013) hat Gisela Kraft die Gründe für diesen Umzug sehr genau beschrieben.
Bevor sie die neue Bleibe mit ihrem Westberliner Hausrat in Besitz nehmen konnte, hatte sie dort in Berlin-Friedrichshain einen Zettel an die Wand gepinnt: „In der Arbeit des Künstlers, in dieser freien Arbeit, wird ein noch unerreichter Zustand der Gesellschaft vorweggenommen“. (Ernst Fischer, österreichischer Kommunist, 1899-1972) Die Worte „in dieser freien Arbeit“ waren unterstrichen. Gisela kam aus einer Welt, in der man sich „diese freie Arbeit“ vor allem mit Lohnarbeit zum Broterwerb auf einem ganz anderem Gebiet er-kaufte. Sie wollte in eine Gesellschaft, in der es möglich schien, ausschließlich vom Schreiben leben zu können.
Von heute (2016) aus wirkt der Satz von Ernst Fischer wie ein Credo der Dichterin bei ihrem Neuanfang im Niemandsland. Das Fragment DDR, heute ein Krakel auf der „Geschichtenwand“, schien im Vergleich zu ihrer bisherigen Welt, in der es keine unerreichten Ziele zu geben schien, außer vielleicht dem, reich zu werden, für Gisela Kraft ein unbestelltes Feld zu sein, das nur darauf wartete von ihr beackert zu werden. Gesellschaftsübergreifende Visionen heute? Fehlanzeige! Visionen sind nicht nur ausgegangen, sie werden weder gebraucht, noch vermisst. Oder wie es in einem meiner Lieder heißt: Die Zukunft geht schwanger ohne Kind.
Meine Freundin, DDR-Bürgerin mit Westberliner Wurzeln, stellte 1984 ihre Baumarkt-Regale, Bücher und Teller in die ihr zugewiesene Wohnung mit „Tag-und-Nacht-Musik“ vom gegenüberliegenden Güterbahnhof und ging ihren Kühlschrank zu füllen zum ersten Mal in eine Ostberliner Kaufhalle. Kaufhalle? – ein Fremdwort für die Sprachkundige. Im Westen sagte man Supermarkt. Es war so vieles super im Westen.
Zwei Bauarbeiter am Imbissstand schauten amüsiert auf das Outfit der Achtundvierzigjährigen; bunte Pluderhosen, darüber Walle-Gewänder, Schlangenketten um den Hals, das strohblonde Haar zu Zöpfen geflochten, goldene Schuhe aus Kunstleder Größe 44!
Der eine Bauarbeiter zu dem anderen: „Kiek ma, n‘ Arsch wie ’ne 85er Bildröhre“…
Die Neubürgerin, Doktor h.c., reagierte mit dem Satz: „Und Ihr habt Plasteeier.“
Stille.
Die Bauarbeiter hatten ihre Bocki noch immer unangebissen in der Hand, starrten mit offenen Mündern auf den Ausgang der Kaufhalle, bis die Exotin eine viertel Stunde später den Männern zuwinkend, mit vollem Einkaufskorb entschwand.
Immer wieder hat Gisela diese Geschichte – ihren Einstand in den DDR Alltag – erzählt. Jahre später wird sie notieren: „Seltsam, wie ich in der DDR meinen lebenden Lieblingsmenschen begegnete… Gern sein – gernhaben.“
Sommer 1990:
Wir saßen in ihrer Wohnung in der Helsingforser. Meine pubertierende Tochter durfte in ihren Schmuckschatullen nach Schätzen graben. Naher Osten, Orient, China, Giselas Welterkundungsreisen, Lebensstationen, quollen in Form von glitzernden Armreifen, strassbesetzten Haarkämmen, Silberketten, Schnallen, Gürteln, Broschen aus den Schatullen. Der Hit war die mit den feingliedrigen Metall-Schlangen aus Silber, bemaltem Holz und Alpaka. Die Schlangen hatten rubinrot oder türkis funkelnde Augen, gespaltene, paillettenbestickte Leder-Züngelzungen. Lange, kurze, kleine, dicke, dünne, die man sich als Kette, Armband oder Gürtel anlegen konnte. Eine Referenz an die Zeit mit dem chinesischen Ehemann, der Schlangen in ihrer Westberliner Wohnung züchtete. („Prinz und Python“, Verlag Eremiten Presse 2000)
Die Schlafzimmertür in der Helsingforser, der Eintritt in „1000 und eine Nacht“. Bunte Tücher über Lampen und Bett und Sessel gebreitet, wallende Gewänder an Kleiderständern, Berührungsreliquien, in die meine Tochter wie in Kokons kroch. Die Heilige, von der sie stammten, war Gisela. Das Kind überglücklich.
„Willst Du vielleicht mal bei mir übernachten und Söfchen betreuen, wenn ich nicht da bin“, fragte Gisela. Sie hatte Lesungen am anderen Ende der DDR und bislang noch keinen Katzenbetreuer gefunden. Ich wusste aus diversen Besuchen in ihrer Wohnung um Söfchens Aggressionspotenzial gegenüber Fremden, aber auch wie man es außer „Kraft“ setzen konnte mit frischem Schabefleisch.
Gisela fuhr zu ihren Lesungen. Kaum war die Tochter mit Söfchen allein in der Wohnung, rettete sich die 12jährige vor der fauchenden Wadenbeißerin mit einem Pfund Schabefleisch und ihren Schulsachen mit einem Sprung auf den Arbeitstisch der Dichterin. Sie fischte mit Giselas längster Metallschlange nach dem Telefon, und rief nach Rettung aus dem Raubtiergehege, in das sie geraten war. Galeristin und Hausfreundin Dörte erschien und sah das Kind mit Giselas Schmuck behangen auf dem Dichterinnentisch zwischen Novalisbüchern und Nazim-Hikmet-Gedichten, Schabefleischklümpchen werfend auf Söfchen, die diese mit hoch gestelltem Schwanz in Kampfposition verschmähte. Noch nach Wochen wurden als Ursache üblen Geruchs Fleischreste auf Tapete und Scheuerleisten ausfindig gemacht.
Giselas geliebte Sophia war übrigens ein Geschenk des Dichters Hinnerk Einhorn, benannt nach Novalis‘ Geliebter. Die Westberliner Katze Leila hatte den Umzug der Herrin in den real existierenden Sozialismus mit ihrem Ableben quittiert.
Die Affinität meiner Tochter zu Giselas Schmuckschlangen erstaunte mich und rief mir die wunderbaren Stellen in meinem Lieblingsbuch „Müllname – Vom Abschied der Gegenstände“, 1984 beim Verlag Eremiten-Presse, Düsseldorf erschienen, ins Gedächtnis.
„Er erkannte blinzelnden Auges zwei Drahtstummel, die sich wie giftige Vipernzungen aus der Decke wanden. Mein Gott, was ist passiert, fragte Herr Kunert“, heißt es dort gleich auf den ersten Seiten.
Das Buch verdankt seine Entstehung einer kleinen Nachricht aus dem Tagesspiegel: eine Rentnerin wurde Opfer einer Verwechselung. Eine Wohnungsauflösungsfirma hatte sich im Stockwerk geirrt. Die gesamte Habe der alten Frau befand sich bereits auf der Müllkippe, als sie vom Wochenendeinkauf heimkehrte und ihre Wohnung besenrein vorfand. Was Giselas Kopfkino aus dieser Zeitungsnachricht in „Müllname“ gemacht hat, ist ein sprachliches Meisterwerk und nicht allein das, es ist eine Allegorie auf unser Verhältnis zu den Dingen. Ich war derart begeistert von dem Buch, dass ich es noch handwarm vom Lesen, zu Ulla Werner ins Maxim-Gorki-Theater brachte, weil mir das Ein-Frau-Bühnen-Stück „Müllname“ mit ihr in der Hauptrolle bereits vor Augen stand. Hat leider nicht geklappt. Die schönsten Ideen vertrocknen irgendwann im Kopf, wenn man den richtigen Leuten zu deren Verwirklichung nicht im richtigen Moment begegnet.
1997 dann die sich seit längerem abzeichnende Flucht der Dichterin aus der Berliner Republik nach Weimar. Sie suchte, um ihre Schreiblust zu fördern, das Kleinteilige, Überschaubare, Beschauliche.
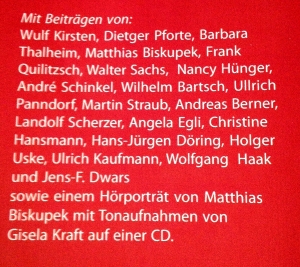
Autoren
Wir hatten in diesem Jahr nicht wenige gemeinsame Auftritte. Bei langen Autofahrten zu zweit blieb es nicht aus, dass wir uns gegenseitig auch über unsere momentanen „Kampfzonen“ informierten. Auf dem Marktplatz Weimar gibt es Dank eines dreieinhalbjährigen „Kraft“-Akts von Gisela seit 2001 eine in den Boden eingelassene Platte: Hier stand das Haus, in dem Jean Paul von 1798-1800 lebte und arbeitete. Ein Stolperstein der besonderen Art. Wer Gisela Krafts Roman „Madonnensuite“ (1998 Verlag Faber & Faber) gelesen hat, in dem es ein fiktives Gespräch zwischen Tieck, Novalis und Jean Paul (alias Johann Paul Friedrich Richter 1763–1825) gibt, versteht, warum ihr die Ehrung von Jean Paul in Weimar ein Herzensbedürfnis war.
Ich musste die Bodenplatte auf dem Marktplatz unbedingt in Augenschein nehmen. Es war Markttag. Auf dem eingelassenen Gedenkstein stand ein Verkaufsstand. Wir krochen – Widerrede zwecklos – unter den Stand. Das machte uns sofort verdächtig. Die Marktfrau ließ ihre Kunden stehen, bückte sich zu uns hinunter. „Haben sie etwas verloren?“ „Nein“, sagte Gisela, „ich wollte meiner Freundin zeigen wo das Wohnhaus…“ Die Marktfrau keifte: „Hier hat keiner gewohnt, hier steht Mittwochs und Sonnabends mein Stand. Schon immer. Wenn Sie nichts kaufen wollen, verlassen Sie bitte meinen Stand!“
Ich nannte Dich an diesem Tag die Sisyphus-In. Dir war kein negatives Gefühl von Vergeblichkeit anzumerken. Wir hakten uns unter und gingen Schnaps trinken. Die Unmengen Schnaps, die Dein Körper vertrug, sind mir heute noch ein Rätsel.
2006, als man der Poetin Gisela Kraft den Weimar-Preis verlieh war sie, wie auch 2009, als sie für ihre Nazim-Hikmet-Nachdichtungen den Christoph-Martin-Wieland-Preis erhielt, die strahlende Sonne Thüringens – eine Zeitung titelte: Kraft im Glück. Nur wenige Freunde wussten zu diesem Zeitpunkt, dass die anthroposophisch ausgebildet Gebildete einer schulmedizinischen Behandlung ihres Krebsleidens nicht zugestimmt hatte. Die Gründe habe ich nie verstanden, sie aber – weil ich sie geliebt habe – sogar in ihrer Verweigerungshaltung bestärkt.
Nur ein Jahr lang konnte sie die späte Anerkennung ihres Werkes genießen, bevor sie ihrem Krebs erlag.
Einmal gab sie mir ihr Tagebuch zu lesen. „Schau mal hier, da war ich noch nicht einmal zehn, meine erste Selbstreflexion“ – die junge Westberliner Bürgertochter Gisela Kraft notierte ein Jahr nach Kriegsende: „Warum bin ich allein ich, alle anderen sind nicht ich? Warum ist es immer so schwarz, wie bin ich hierher geraten?“
Ich würde gern beim nächsten Weimarbesuch auf dem Marktplatz eine Bodenplatte aus Kupfer aufsuchen, auf der steht:
In dieser Stadt lebte und arbeitete von 1997– 2010 die Dichterin, Schriftstellerin und Übersetzerin Gisela Kraft. Du fehlst. Deine Freunde und die Stadt Weimar.
Wollen wir alle zusammenlegen?
Abschied
Am 6. April ist Burkhart Seidemann, Theologe, Pantomime, Theaterleiter, Regisseur, Fantast, Realist, Utopist, Menschen Zugewandter, sich um andere Seelen Sorgender in Berlin mit 72 Jahren gestorben.
Vor einigen Jahren hatten wir uns mal als Frau Merkel & Herr Kohl zum Neujahrsempfang der LINKEN unters Volk gemischt und unter unseren Gummimasken Tränen gelacht über manch moralinsaure Reaktion unserer in feines Tuch gehüllten Parlamentarier.

Mensch Burkhart, nun warten Deine Bücher in der Stargarder Strasse darauf von uns mitgenommen, gelesen und gehütet zu werden.


Du fehlst!!!! Schon jetzt !!!!! Wir waren diese Woche verabredet. Warum ging es plötzlich doch so schnell?
Sicher wirst da oben Jean Pacalet wiedertreffen und auch Bettina Schubert vom Hackeschen Hoftheater, Deiner langjährigen Wirkungsstätte. Und irgendwann werden auch wir uns wiedersehen. Denn der Tod ist ja keine Erfahrung, sondern eine Widerfahrung, die nur in den Herzen der Weiterlebenden ausgehebelt werden kann.
In Traurigkeit und Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit hier unten.
Deine Barbara
Post aus Deutschland
Über eine „Fanpost“ habe ich mich in den vergangenen Tagen besonders gefreut. Ich möchte das daher hier dokumentieren:
Hallo Frau Thalheim,
Während einer Recherche, um meinen Lebenslauf schriftlich zu komplettieren, stieß ich auf Ihren Artikel über Guinea Conakry von 2010. ich muss sagen dass ist wirklich ein schönes Stück Arbeit, es erinnert mich an meine Heimat, denn ich komme aus Guinea, bin dort aufgewachsen und habe vieles erlebt. An diesem Morgen war dies das einzige was mir sowohl ein Lächeln als auch eine Träne ins Gesicht zaubern konnte. Dafür möchte ich Ihnen alle mal erstmal danken, und würde, sofern es Ihnen genehm ist gerne einige Informationen mit Ihnen austauschen. Ich war 2005 das letzte mal in Guinea, seitdem bin ich hier in Deutschland und mit meinem Leben und der Arbeit beschäftigt.
Ich würde mich über eine Konversation mit Ihnen freuen.
Danke im Voraus, und einen angenehmen Arbeitstag.
Lieben Gruß,
Mohamed Y. J.
Ich habe mich natürlich zurückgemeldet:
Jaa, lieber Mohamed Y. Jallo,
Auch ich habe mich sehr über Ihre Mail gefreut.
Bei all dem Bullshit, der zur Zeit im Netz über Asylsuchende in Deutschland kursiert, tut so eine Mail richtig gut.
Zu meinem Guinea-Artikel gibt es noch einen kleinen Film – anbei der Link.
Entscheidend für das Verhältnis zu anderen Menschen auf diesem Planeten ist immer die persönliche Begegnung. Je mehr Fremde, desto weniger Angst vor Fremden.
Ich melde mich bei Ihnen.
Liebe Grüße,
Barbara
Cabu

Cabu
Heute vor einem Jahr wurde in Paris fast die gesamte Redaktion der Zeitung „CHARLY HEBDO“ erschossen.
Auch der kleine verschmitzte Mann mit Pagenfrisur, der aussah, als wäre er ein im Mittelalter aus einem Benediktinerkloster entlaufener Mönch.
Jean Cabut , 1938 – 7.1.2015, genannt Cabu, war gern gesehener Karikaturist in französischen Ferseh-Talkshows.

Cabu mit Werkzeug
Ich lernte ihn in den 90er Jahren in einer ARTE Sendung kennen, in der er Mitwirkende – so auch Jean Pacalet und mich – karikierte. Wir freundeten uns an.
Cabu schenkte uns Zeichnungen, u.a. die, de es auf das Cover unserer CD „Fiere de ma grande Gueule“ schaffte.
Cabu, ich denke heute an Dich, an Deinen großartigen Humor, der treffen, ja auch verletzen konnte, aber niemals töten.
in memoriam
Barbara

Grafik von Cabu auf dem CD-Cover
Das NEUE JA…
… musste ich mir dieses Mal „erarbeiten“, und zwar im „Silvestival“ von Arnulf Ratings Maulheldenvarieté im Kleistforum Frankfurt/Oder.
Hier einige Probenfotos vom 31.12. mit meinen Musikussen
Rüdiger Krause, Felix Otto Jacobi und Topo Gioia.
Als der Bus mit den Mitwirkenden am 1.1.2016 früh um 6 Uhr ins rauchverpestete Berlin einfuhr, waren die Trottoirs bedeckt mit Feuerwerksresten; einige Totalabgefüllte torkelten bekotzt, bepisst über Straßen und Plätze, Feuerwehren kreuzten sich. Die Luft war Amoniak und Schwefel geschwängert. Ein Hund saß winselnd und zitternd hinter einem überbordenden Mülllcontainer, aus dem Ratten sprangen.
Wenn man mich (als NEUES JAHR) so begrüßen würde – ich würde gar nicht erst erscheinen.
Ich hab mir zwischen meinen Auftritten im Silvestival von Rating auch Kollegen ansehen können und möchte hier ein Loblied auf die Herren Niels und Tschirpke singen.
Und falls mir jemand einen Ort in Deutschland mit hundertprozentiger Stillegarantie am 31.12. nennen könnte,wäre ich…….
mehr als dankbar.
B. Thalheim
Jahresendgedanken
Nun ist es fast vorbei – das Jahr 2015.
Für Böller und Neujahr-Begrüßungsraketen werden allein in Deutschland heute, morgen, übermorgen 129 Millionen Euro ausgeben. 2005 waren es „noch“ 96 Millionen.
Man stelle sich den 31.12. mal so vor: Abendstimmung, ein total leises Land stellt die Uhren um auf Anfang und sammelt (ob seines Reichtums) in Demut das Geld ein, das es Umwelt verpestend verballert hätte.
Mit dem Geld werden LAGESO-Mitarbeiter, Sozialsenatoren, geistig behinderte Bayerische Politiker gecoacht, Flüchtlingsheime auf Spiekeroog gebaut und stiernackige Thor-Steinar-Dumpfbacken aus Garz (Usedom) in die afrikanische Sonne zum Brunnenbauen verschickt.
129 Millionen Euro dafür, dass die Verhinderer einer Bunten Republik Deutschland gehirngewaschen werden. Das könnte reichen. Wir schaffen das!
 Ich freue mich erst einmal auf das Silvestival 2015 am 31.12. mit Arnulf Rating im Kleistforum Frankfurt/Oder. Bei so einer netten Ankündigung von Thalheim & Band könnte der Versuch aktuelle Songs in ein Silversterprogramm zu schmuggeln vielleicht klappen. Anstelle von Wiglaf Droste wird Marco Tschirpke das Ensemble mit seinen Lapsus-Liedern komplettieren. Harry Rowohlt – Gott hab ihn selig – meinte zu Marcos – der Mann ist eigentlich Pianist – genialen Versen:
Ich freue mich erst einmal auf das Silvestival 2015 am 31.12. mit Arnulf Rating im Kleistforum Frankfurt/Oder. Bei so einer netten Ankündigung von Thalheim & Band könnte der Versuch aktuelle Songs in ein Silversterprogramm zu schmuggeln vielleicht klappen. Anstelle von Wiglaf Droste wird Marco Tschirpke das Ensemble mit seinen Lapsus-Liedern komplettieren. Harry Rowohlt – Gott hab ihn selig – meinte zu Marcos – der Mann ist eigentlich Pianist – genialen Versen:
„Wem Heinz Erhardt zu naiv-kindlich, Robert Gernhardt zu unpolitisch und Goethe zu langohrig ist, der findet in Marco Tschirpke auch keine Alternative.“
Mein linker, linker Platz ist leer – auf die Busfahrt nach Frankfurt – wünsch ich mir den Marco her….. der Typ ist irgendwie ne Versicherung gegen den Verblödungsgrat der Gesellschaft.
Soll heißen ein Wendehoffnungsträger!
Deshalb tut mir auch Christian Haase, der Rockpoet, recht gut. In meiner aktiven „Tournierungszeit“ hätte ich nie daran gedacht, mich mit einem Rocker zu DUO-lieren. Und nun ist das nächste Jahr mit unserem Programm „Krampf der Generationen“ fast durchterminiert. Schön ist mit Haase auf der Bühne, vor allem seine Lieder zu begleiten, mitzusingen, noch schöner aber ist unser Austausch zu allem was Läbn so ausmacht. Neulich hat mich der Jungspund gefragt wer Franz Hohler ist. Ich wollte wissen, wie das „erste Mal“ bei ihm war. So „technisch“. Dreizehn war er. Hallelujah. Da kam ich mir fast wie Siebzig vor. Den Rest kann man im Programm „Krampf der Generationen“ erfahren.
Ich wünsche uns allen ein bewusstes Hinübergleiten ins NEUE JA und – frei nach Gundermann – Fernseher aus, Sternschnuppen an „…ich will so lang die Sterne zählen, bis mir die Zahlen fehlen“ (aus einem Haase-Song).
Den Hiddensee-Freunden und -fans gezeitengewaltige Spaziergänge am Meer!
Ich freue mich auf ein gutes Silvesterkonzert mit meiner Band, in der sich jetzt der geniale Kontrabass-Dompteur Felix Otto Jacobi öffentlich beim zärtlich- sinnlich- groovenden Umarmen und Traktieren seiner „Oma“ zusehen läßt.
Auf ins 2016er Jahr und gutes Tun, jeder an seinem Platz!
Barbara Thalheim




